Die grasgrünen Haare
© Ronald Henss


Der Wecker klingelte wie immer Punkt 6:30. Elfriede Wohlfahrt war ein wenig verwundert, wurde sie doch gewöhnlich ein paar Minuten vor dem Wecker wach. Etwas langsamer als sonst richtete sie sich auf, setzte sich auf die Bettkante, steckte ihre Füße in die Pantoffeln und rieb ihre Augen, die heute ein wenig müder waren als sonst. Dann stellte sie sich wie jeden Morgen kurz auf, raffte das lange Baumwollnachthemd über den Po und ließ sich auf die Bettkante zurückplumpsen. Dann zog sie das Nachthemd über den Kopf, faltete es sorgfältig zusammen und legte es neben sich auf die Bettdecke. Wie jeden Morgen schaute sie an sich herunter. Ihr mächtiger Busen versperrte den Blick, sodass von ihrem üppigen Körper nur noch die Knie sichtbar waren. Sie fühlte sich wohl mit ihren ausgeprägten weiblichen Rundungen.
Wie jeden Morgen packte sie mit beiden Händen lustvoll ihre schweren Brüste. Ihr voller Busen war immer noch fest und straff. Nach einer kurzen Weile des sinnlichen Genusses ergriff sie den bereitliegenden frischen BH. Elegant glitten ihre Arme in die Träger, sie presste die Körbchen eng an ihre Brüste, griff nach hinten und knipste den Verschluss zu. Dann schloss sie wie jeden Morgen kurz die Augen, bog ihren Rücken durch, richtete genussvoll ihren Oberkörper auf, legte den Kopf in den Nacken und seufzte leise.
Bedächtig stand sie auf, reckte sich und streifte ihre weiße Baumwollunterhose ab. Bevor sie die bereitliegende, ebenfalls weiße frische Baumwollunterhose ergriff, packte sie mit beiden Händen ihre Pobacken. Auch die waren immer noch fest. Fest und üppig wie ihre Brüste. Sie schlüpfte in die frische Baumwollunterhose, zog sie nach oben, fuhr mit beiden Daumen unter den Gummi, zog ihn ein wenig nach vorn, drehte in einer raschen Bewegung die Daumen nach außen und ließ den Gummi genussvoll auf ihre Speckröllchen schnellen. Ja, sie war mit sich und ihrem Körper zufrieden. Einhundertsechsundsiebzig Pfund dralle Weiblichkeit bei einhundertachtundsechzig Zentimetern Körpergröße.
Wie jeden Tag setzte sie sich, bekleidet mit frischer wohlduftender Unterwäsche, auf den Bettrand und ging im Geiste das Tagesprogramm durch. Frühstück, Aufräumen, Bettenmachen, kleines Päuschen mit Zeitunglesen, Einkaufen, Mittagessen zubereiten, Essen, Abwaschen, ein kleines Päuschen. Nein, heute Mittag würde Jessica nicht nach der Schule zu ihr kommen. Heute stand nämlich etwas Besonderes auf dem Programm: Für 15:30 war sie im Salon Schiller angemeldet. Es war höchste Zeit, ihre Dauerwellen wieder in Ordnung bringen zu lassen. Elfriede Wohlfahrt freute sich auf diese Abwechslung. Der Besuch im Frisiersalon war für sie nicht nur ein notwendiger Akt der Körperpflege, er war vor allem auch ein soziales Ereignis, das einen Glanzpunkt in ihren Alltag setzte. Der heutige Tag hatte also etwas zu bieten.
In bester Laune stand sie auf, um wie jeden Morgen ihre üppigen weiblichen Rundungen im Spiegel zu bewundern. Als sie vor den großen Spiegel trat, packte sie das Entsetzen. „Neeeeeeiiiiinnnn!!!“ – „Hiiiiiiiiiiilllllfe!!!“ – „Nein, das kann nicht sein!!!“ – „Um Gottes willen, was ist das?“ Sie konnte einfach nicht glauben, was sie sah. Sie presste die Augen zu, drückte beide Hände fest auf das Gesicht und ließ die Hände langsam zum Hals hinabgleiten. Dann presste sie die Handflächen wie zum Gebet zusammen. Die beiden Daumen fest auf den Kehlkopf gedrückt, das Kinn auf die Spitzen der beiden Zeigefinger gestützt, die Kuppe der Mittelfinger an die Kinnspitze gedrückt, flehte sie mit geschlossenen Augen „Oh Gott, lass das nicht wahr sein! Bitte, bitte! Mach, dass ich das alles nur geträumt habe!“ Vor Angst und Erregung zitternd öffnete sie langsam die Augen.
Aber alles Beten, Hoffen und Flehen hatte nichts geholfen. Sie achtete nicht auf ihre sinnlichen rundlichen Formen. Auch nicht auf die weit aufgerissenen Augen und das verzerrte Gesicht. Nein – voller Entsetzen, Panik und Angst sah sie nur eines: Ihr Haar war grün! Grasgrün! Ein sattes, saftiges, kräftiges Grasgrün!
Elfriede Wohlfahrt konnte es nicht fassen. Wie auch? So etwas konnte man gar nicht fassen. Das war einfach unbegreiflich. ‚Nein, das darf nicht sein! Bitte, bitte lieber Gott, lass mich nicht wahnsinnig werden!‘ In tiefster Verzweiflung schloss sie die Augen, eilte zum Bett, warf sich auf den Bauch, presste das Gesicht fest in die Matratze und zog ein Kopfkissen über ihren Hinterkopf. ‚Bleib ruhig, Elfriede. Ganz ruhig. Das war eine Sinnestäuschung, eine Halluzination. Komm erst mal zur Ruhe, dann wirst du sehen, dass alles in Ordnung ist. Vielleicht ist es auch nur eine Sehschwäche.‘ Es dauerte eine ganze Weile bis sich ihr Herzschlag wieder beruhigt hatte. Allmählich wich ihre Angst, ihre Atemzüge wurden regelmäßiger und das Zittern ebbte ein wenig ab.
Mühsam richtete sie sich auf, setzte sich auf die Bettkante, vergrub ihr Gesicht in den Händen und versuchte ihre Gedanken zu ordnen. ‚Egal, was du im Spiegel sehen wirst, Elfriede, du bist nicht verrückt. Du bist eine starke Frau, Elfriede, und du wirst damit fertig werden.‘ Wankend zwang sie sich vor den Spiegel. Nein, das waren keine Sinnestäuschungen, keine Halluzinationen, keine Sehschwäche. Ihr Haar war grün, grasgrün. Wie sattes saftiges grünes Gras. Als sie mit beiden Händen durch ihre Dauerwellen fuhr, war sie überrascht. Ihr Haar fühlte sich genauso an wie immer. Sie kräuselte die Locken zwischen ihren Fingern, aber es war nicht der geringste Unterschied zu spüren. Nur diese Farbe. Diese entsetzlich grüne Farbe. Was, um Gottes willen, war nur geschehen?
Elfriede Wohlfahrt wusste, sie brauchte Hilfe. Und zwar sofort. Ganz, ganz dringend. Hastig rannte sie zum Telefon. Ihre Hände zitterten und vor Aufregung brachte sie es nicht fertig, die Nummer ihrer Tochter zu wählen. Sie war nahe dran, hysterisch aufzuschreien, als ihr endlich einfiel, dass sie die Nummer eingespeichert hatte und dass sie doch nur den Speicherplatz 1 zu drücken brauchte. ‚Los Christina, geh dran! Bitte, bitte, geh dran!‘
Als das Telefon klingelte, war Christina zunächst verwirrt, weil sie im ersten Moment dachte es sei der Wecker. ‚Ach nein, das Telefon. Wer um Himmels willen ruft denn in aller Herrgottsfrühe an? Sicher wieder verwählt.‘ „Ja, Hallo! Hier Christina Hartmann.“
„Christiina, Christiiinaa!“
Sofort wusste Christina, dass etwas Schlimmes passiert sein musste.
„Christina, du musst sofort herkommen! Es ist was Schreckliches passiert!“
So hatte Christina ihre Mutter noch nie erlebt. „Aber Mama, was ist denn los? Beruhige dich doch!“
„Komm her, komm! Mach dass du kommst!“
„Aber sag doch, was ist passiert?“
„… kann nicht … selbst sehen …“
„Mama! Um Gottes willen, Mama! Ich komme sofort. Mama, Mama!! Mama, halt durch!“
Voller Panik rannte Christina in den Flur, riss den Autoschlüssel vom Schlüsselbrett und schrie so laut sie konnte „Kaaarrrlll!! Ich muss sofort zu Mama. Es ist irgendwas Schreckliches passiert. Du musst dich um Jessi kümmern.“
Ehe Karl antworten konnte, hörte er wie die Haustür zuknallte. Wie sollte er sich jetzt um Jessica kümmern, wo er doch um acht im Büro sein musste?
Elfriede Wohlfahrt ließ den Hörer zu Boden fallen. In panischer Angst rannte sie ins Bad und schnappte die Schere. Aber als sie eine der grasgrünen Locken abschneiden wollte, traf sie der Schlag. Das Haar ließ sich nicht abschneiden. So sehr sie sich auch bemühte – es gelang ihr einfach nicht, auch nur ein einziges Haar abzuschneiden. Als Elfriede Wohlfahrt in Ohnmacht fiel, hatte sie unfassbares Glück, dass sie sich weder mit der Schere verletzte noch mit dem Kopf an der Badewanne aufschlug.
Christina hatte gar nicht wahrgenommen, wie sie zum nahe gelegenen Haus ihrer Mutter gelangt war. Als auf ihr Sturmklingeln niemand aufmachte, schlug sie kurzerhand eine Scheibe ein und kletterte durchs Fenster. „Mama, Mama! Wo bist du? – Mama, Mama, so sag doch was. Bitte! Wo bist du?“ Küche nein, Wohnzimmer nein, Schlafzimmer nein. Als Christina ihre Mutter regungslos auf der Fußmatte im Bad liegen sah, war sie erleichtert und entsetzt zugleich. „Mama, Mama, was machst du denn für Sachen? Mama, wach auf!“ Geistesgegenwärtig füllte sie den Zahnputzbecher mit kaltem Wasser und schüttete es ihrer Mutter ins Gesicht. „Mama, wach doch auf! Mama, Mama, was machst du denn für Sachen? Warum hast du dir bloß die Haare so schrecklich gefärbt?“ Dann nur noch ein einziger hysterischer Schrei: „Mammmaaa!!!“
Unter Aufbietung aller Kräfte schleppte Christina ihre füllige Mutter ins Schlafzimmer und hievte den mächtigen aber straffen und angenehm weiblichen Körper aufs Bett. Als Elfriede Wohlfahrt endlich aus der Ohnmacht erwachte, dauerte es noch eine halbe Ewigkeit bis sie schluchzend, weinend, schreiend, bebend, zitternd ihrer Tochter berichtet hatte, was passiert war. Christina konnte es nicht glauben. Das war einfach unfassbar. Erst als sie selbst versuchte, mit der Schere ein grasgrünes Haar abzuschneiden, wusste sie, dass ihre Mutter nicht wahnsinnig geworden war und dass sie keinen üblen Schabernack mit ihr trieb. Christina war nun selbst nahe dran, den Verstand zu verlieren. Dass die Haare grasgrün waren, war vielleicht noch irgendwie zu begreifen – aber dass es absolut unmöglich war, auch nur ein einziges Haar abzuschneiden, überstieg jegliches Vorstellungsvermögen. Hier waren Kräfte am Werk, die nicht mit dem menschlichen Verstande zu erfassen waren.
Als Christina wie eine Wahnsinnige an der Bushaltestelle vorbeigerast war, konnten die verdatterten Rentner nur stumm den Kopf schütteln. Was war heute nur los? Der Bus stand schon lange bereit, der Busfahrer hatte schon längst die Geduld verloren, aber kein Mensch ließ sich blicken. Ratlos und verloren standen sie da, Ernst, Hans-Walter, Heinrich und Adolf. So etwas hatte es noch nie gegeben. Die Seniorenfahrt war seit Wochen ausgebucht, die Abfahrtszeit war schon lange überschritten, doch weit und breit war niemand zu sehen.
Plötzlich hatte Heinrich einen Gedankenblitz: „Ist euch schon aufgefallen, dass wir vier die einzigen Witwer in der Gruppe sind?“
„Oh ja, das stimmt ja.“
„Du hast Recht, Heiner, der Hans, der Herbert und der Karl sind verheiratet und von unserer großen Schar der lustigen Witwen fehlt jede Spur.“
„Das kann doch nur an den Frauen liegen. Das ist bestimmt kein Zufall. Die haben irgendwas ausgeheckt.“
„Na ja, dann schauen wir halt so lange den Schulmädchen nach, die sind ohnehin viel leckerer als unsere betagten Damen.“
„Du alter Lustgreis!“
„Hähä!“
Zu dieser Zeit herrschte im Sankt Marien Hospital bereits seit Stunden die hellste Aufregung. In aller Frühe hatte Schwester Elisabeth eine schockierende Entdeckung gemacht. Als sie das Zimmer 407 betrat, traute sie ihren Augen nicht. Frau Lauer und Frau Recktenwald lagen friedlich schlafend im Bett – aber mit grünen Haaren. Jawohl, mit grasgrünen Haaren! Rasch bekreuzigte sich Schwester Elisabeth „Oh, Großer Gott! Steh mir bei!“ Dann schaute sie noch einmal genau hin: Fräulein Werner und Frau Holzer lagen da wie immer; Fräulein Werner mit ihrem langen seidigen blonden Haar und Frau Holzer mit ihrer wallenden kastanienroten Lockenpracht. Aber ausgerechnet Frau Lauer und Frau Recktenwald, diese beiden liebenswürdigen alten Damen, hatten grasgrüne Haare. Kein Zweifel, es war ein sattes saftiges Grün. „Oh, Jesu hilf mir! Vater unser, der Du bist im Himmel …“ Rasch, aber so leise wie sie nur konnte, inspizierte Schwester Elisabeth die anderen Zimmer. Mit Ausnahme von Zimmer 418 bot sich ihr stets der gleiche Anblick: Alle älteren Damen hatten grasgrüne Haare. Nur Oma Jenneweins Haar hing in würdevollem Grau über die Bettkante herab. „Oh Herr, steh mir bei! Oh Jesu, hilf!“
Schwester Elisabeth war eine erfahrene und besonnene Schwester. Als sie den ersten Schock überwunden hatte, wusste sie, was zu tun war. Als Erstes rief sie bei Pfarrer Gotthold an, dann ließ sie den Klinikdirektor Professor Eckstein verständigen. Beide würden so schnell wie möglich herbeieilen. Einzelheiten durften nicht über das Telefon besprochen werden. ‚Ruhe bewahren. Nur keine Aufregung. Nur keine Panik. Vater unser, der Du bist im Himmel …‘ Nach kurzer Rücksprache mit der technischen Leitung rief sie reihum alle Stationsschwestern an. Das Wecken müsste heute unbedingt um eine Stunde nach hinten verschoben werden. In wenigen Minuten würden die Stromkreise III und IV unterbrochen werden, also kein Licht auf den Stationen. Die Stromkreise I und II, die die medizinisch notwendigen Gerätschaften speisten, würden aber weiterhin funktionieren. Was immer auch geschehen würde – Ruhe bewahren, keine Aufregung, keine Panik, weitere Anweisungen abwarten.
Nur wenige Minuten später eilten Pfarrer Gotthold und Professor Eckstein herein. Sie waren schon im Fahrstuhl aufeinander geprallt, beide ganz aufgeregt, aber keiner wusste was geschehen war. Schwester Elisabeth schilderte die Lage ruhig und sachlich und sie schien bei klarem Verstand zu sein. Gleichwohl war diese Geschichte zu phantastisch. Erst als sie sich mit eigenen Augen überzeugt hatten, wurde Pfarrer Gotthold und Professor Eckstein das Problem allmählich bewusst. Pfarrer Gotthold wurde mit dem seelischen Beistand für die Schwesternschaft und die Patienten betraut, Schwester Elisabeth sollte die Notfallmaßnahen auf den verschiedenen Stationen koordinieren, Professor Eckstein übernahm die zentrale Leitung.
Als Erstes musste sich der Professor ein Gesamtbild verschaffen. Reihum ließ er sich über die Lage auf den Stationen informieren. Es war wie verhext. Grasgrüne Haare, fast überall. Aber auf der Männerstation war alles ruhig wie immer. Keine besonderen Vorkommnisse. Als Schwester Angelika meldete „Auf der Entbindungsstation ist alles im grünen Bereich“, zuckte Professor Eckstein zunächst zusammen. Zum Glück fragte er noch einmal nach und konnte dann erleichtert zur Kenntnis nehmen, dass auch auf der Entbindungsstation alles in Ordnung war; eben, wie man so schön sagt: alles im grünen Bereich. Aber für solche Sprachspielchen hatte Professor Eckstein jetzt keinen Sinn. Die Lage war ernst. Bitterernst. Hier war klarer logischer Sachverstand gefragt. Merkwürdig, sehr merkwürdig! Warum betraf es nur Frauen und keine Männer? Und warum war ausgerechnet auf der Entbindungsstation keine einzige Frau betroffen?
Mitten in seine Überlegungen platzte Schwester Elisabeth mit der nächsten Hiobsbotschaft. Bei der Zusammenkunft der Schwestern im Schwesternzimmer war sie plötzlich wie elektrisiert: Unter der Haube von Schwester Maria lugte ein grasgrünes Haarsträhnchen hervor. Außergewöhnliche Umstände erfordern außergewöhnliche Handlungen, und so musste Schwester Elisabeth alle Mitschwestern auffordern, ihre Haube abzunehmen. Die Aufregung und die Empörung waren groß, aber schließlich mussten sich doch alle der Autorität von Schwester Elisabeth unterwerfen. „Oh, mein Gott! Vater unser, der Du bist im Himmel …“ Es war unfassbar! Ein vielstimmiger Chor von Gebeten wurde gen Himmel gesandt, aber das änderte nichts an den Tatsachen. Fast alle älteren Schwestern hatten grüne Haare. Grasgrüne Haare. Ein saftiges sattes Grün beherrschte die Runde. Nur die jüngeren Schwestern waren verschont geblieben und – merkwürdigerweise – auch Schwester Walburga, Schwester Edelgard und Schwester Luitgard. Schwester Elisabeth traute ihren Augen nicht: Schwester Walburga, Schwester Edelgard und Schwester Luitgard hatten sich unter dem Schutz der Haube heimlich das Haar lang wachsen lassen. Das würde ein Nachspiel haben! Aber im Moment mussten wichtigere Probleme gelöst werden. Für Professor Eckstein wurde die Sache immer rätselhafter. Er musste unbedingt in Ruhe seine Gedanken ordnen.
Elfriede Wohlfahrt und Christina waren mittlerweile zur Tat geschritten. Aber alle Versuche, die grasgrüne Farbe auszuwaschen, waren ohne Erfolg. „Mama, leg dich ins Bett und bleib bitte ganz ruhig. Ich werde rasch zum Supermarkt fahren und Haarfärbemittel und Bleichmittel einkaufen. Bleib ganz ruhig, und reg dich bitte nicht auf. Ich bin sofort wieder da.“
Als Christina das Sammelsurium von Shampoos, Haartönern, Bleichmitteln und Färbemitteln auf das Band legte, konnte Agnes, die stets freundliche Kassiererin, die Welt nicht mehr verstehen. ‚Merkwürdig – Frau Hartmann auch! Warum kaufen heute Morgen alle Leute nur Haarpflegemittel? Wozu brauchen die so viel Zeug? Und ausgerechnet heute hat sich Frau Kipper aus der Hair-Care-Abteilung krank gemeldet. Irgendwas stimmt nicht, irgendwas ist heute anders als sonst.‘ Agnes ahnte nicht, wie Recht sie hatte. Noch vor elf Uhr waren sämtlichen Regale mit Haarpflegeprodukten leergeräumt. Verstörte Kunden mussten vertröstet werden und niemand wusste, was an diesem Tag geschehen war. Oder niemand wollte sagen, was er wusste.
Es war zum Verzweifeln. Egal, welches Mittel Christina auf den Kopf ihrer Mutter schmierte – die grasgrüne Farbe ließ sich nicht entfernen. Jegliche Mühe war umsonst. Elfriede Wohlfahrt war am Ende ihrer Kräfte. Sie wollte nur noch eins. Schlafen, Schlafen, Schlafen. Ruhe, Ruhe, nur noch Ruhe. Cristina führte ihre völlig erschöpfte Mutter zum Bett. Bevor Elfriede Wohlfahrt die letzte Tablette schluckte, murmelte sie noch mit schwacher Stimme „… Termin … Salon Schiller … absagen …“
„Ja, Mama, bleib ganz ruhig, ich werde sofort anrufen. Schlaf gut, Mama.“
„Ja, hallo! Hier ist der Frisiersalon Schiller. Mein Name ist Beatrice Schwarzkopf. Was kann ich für Sie tun?“
Nur mit Mühe konnte Christina ihre Gedanken und ihre Sätze ordnen. Aber die bildhübsche Empfangsdame wusste gleich Bescheid. „Ja, schade, da kann man nichts machen. Richten Sie bitte Ihrer Frau Mutter unsere besten Genesungswünsche aus.“
„Ja, danke, auf Wiederhören.“
Beatrice wickelte eine blonde Locke um ihren linken Zeigefinger und strich mit der rechten Hand sanft über ihren gewölbten Bauch. Nachdenklich flüsterte sie zu dem strampelnden Wüstling: „Mein kleiner Quälgeist, das war jetzt schon die vierte Absage innerhalb einer halben Stunde, und unsere gute alte Frau Wunn hat sich heute auch krank gemeldet.“ Als das Telefon schon wieder klingelte, wusste auch Beatrice Schwarzkopf, dass an diesem Tag alles anders war als sonst.
Christina hatte ihre Mutter liebevoll zugedeckt und die Hände über der Bettdecke gefaltet. Drei extrastarke Schlaftabletten würden ihre Mutter in einen langen Tiefschlaf versetzen. Jetzt musste sie sich unbedingt um Jessica kümmern. Mit Tränen in den Augen küsste sie das friedliche Gesicht „Schlaf gut, Mama. Mach dir keine Sorgen. Ich werde so bald wie möglich zurückkommen. Keine Sorge, Mama. Alles wird gut.“
Professor Eckstein genoss den heißen Kaffee. Zum ersten Mal am heutigen Tag verspürte er Ruhe und Zufriedenheit. Er stellte die Tasse ab, lehnte sich in den schweren Ledersessel zurück und ließ seinen Blick schweifen: St. Josefs Kirche, Christuskirche, Rathaus, Alter Turm – wie friedlich sah doch alles aus! Professor Eckstein war zu einem Entschluss gekommen. Sein erster Impuls war es gewesen, das Stankt Marien Krankenhaus strikt abzuriegeln und alles geheim zu halten. Schließlich stand nicht weniger auf dem Spiel als der gute Ruf der Klinik. Aber nach reiflicher Überlegung und Abwägung aller Argumente hatte er sich auf die entgegengesetzte Strategie festgelegt. Die Erinnerung an die Katastrophe mit dem SARS-Virus war noch zu frisch. Professor Eckstein hatte die Lektion gelernt. Bloß keine Vertuschung! Nur schonungslose Offenheit konnte vor unübersehbaren Folgeschäden bewahren. Nichts aufbauschen, keine Panik, nichts übertreiben – stattdessen Offenheit, Sachlichkeit, Kompetenz, Entscheidungsfreude, entschlossenes Handeln.
Als Erstes setzte sich Professor Eckstein mit dem Gesundheitsministerium in Verbindung, dann mit dem Landeskriminalamt, dem Staatsekretär für Innere Sicherheit, dem Obersten Rat der Landesmedienanstalten und schließlich mit dem Ministerpräsidenten.
In einer noch nie da gewesenen Perfektion wurden im Verborgenen die Fäden gezogen. Binnen weniger Stunden waren die zuständigen Landes- und Bundesministerien, die Landes- und die Bundeskriminalämter, die Geheimdienste, der Katastrophenschutz, die Bundeswehr, die NATO, die Europäische Union, die Weltgesundheitsorganisation und Forschungsinstitute in aller Welt informiert. Rund um den Globus waren die Notfallpläne in Kraft gesetzt. Die Region wurde im Umkreis von 50 Kilometern hermetisch abgeriegelt. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen dem Saarland, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Lothringen, Elsass und Luxemburg verlief reibungslos. Die kompetentesten Wissenschaftler aus den verschiedensten Fachgebieten und aus allen Teilen der Welt waren unterwegs, die ersten Experten waren bereits eingetroffen und arbeiteten fieberhaft an der Aufklärung des rätselhaften Phänomens. Wie durch ein Wunder hatten auch sämtliche Medien die Berichterstattung so lange zurückgehalten, bis an der Wall Street die Börsen geschlossen waren.
Als Elfriede Wohlfahrt am frühen Nachmittag des nächsten Tages ihre Augen aufschlug, konnte sie sich zunächst gar nicht erklären, wieso ihre Tochter Christina hier auf ihrer Bettkante saß. Sie war noch sehr benommen und so dauerte es eine Weile, bis sie das Puzzle in ihrem Kopf einigermaßen geordnet hatte. Elfriede Wohlfahrt schloss die Augen, legte die Hände flach aufs Gesicht und presste die Fingerspitzen fest auf die Augenlider. Dann atmete sie mehrmals tief durch und dachte: ‚Elfriede Wohlfahrt, du bist eine starke Frau. Egal, was kommt – du stehst das durch.‘ Dann richtete sie sich auf und sagte: „Chris, mein Liebes, geh und koch uns einen starken Kaffee.“
Den BH hatte sie noch seit gestern an und es lag auch keine frische weiße Baumwollunterhose bereit. Sie setzte sich auf die Bettkante, steckte die Füße in die Pantoffeln und reckte ihren Oberkörper. Dann stand sie auf, fuhr mit beiden Daumen unter den Gummi ihrer Unterhose, zog ihn ein wenig nach vorn, drehte die Daumen in einer raschen Bewegung nach außen und ließ den Gummi genussvoll auf ihre Speckröllchen schnellen. Danach trat sie entschlossen vor den großen Spiegel und bewunderte ihre üppigen weiblichen Rundungen. Das entsetzliche grasgrüne Haar würdigte sie keines Blickes.
Dann zog sie die dunkelblaue Kittelschürze über und ging zur Toilette. Bevor sie aufstand und die Spülung abdrückte, murmelte sie „Elfriede, du stehst das durch!“
Als Elfriede Wohlfahrt die Küche betrat, blieb sie kurz stehen, schloss die Augen und sog in einem langen Zug den Duft des frisch gekochten Kaffees in ihre Nase. Dann setzte sie sich an den massiven Tisch. „Meine gute Christina, lass uns erst mal in aller Ruhe essen und trinken. Das ist jetzt das Allerwichtigste. Danach kannst du mir erzählen, was passiert ist.“
Als Elfriede Wohlfahrt rundum satt war, rülpste sie leise, streckte ihren Oberkörper, bog den Rücken tief durch, packte mit beiden Händen ihre festen Brüste, schloss die Augen und atmete tief durch. Mit einem lauten „Puuuhhh!“ ließ sie alle Glieder entspannt fallen, setzte sich bequem hin, atmete noch einmal tief aus und sagte: „So, mein Kind, und jetzt erzähl mal, was in den letzten vierundzwanzig Stunden alles passiert ist.“
Was Christina zu berichten hatte, war nicht ganz so schlimm wie befürchtet.
Vor wenigen Stunden war über sämtliche Medien Entwarnung gegeben worden. Es lagen keinerlei Anzeichen für einen terroristischen Anschlag vor. Ein terroristischer Hintergrund konnte mit nahezu absoluter Sicherheit ausgeschlossen werden.
Allem Anschein nach handelte es sich auch nicht um eine ansteckende Krankheit. Alle Fälle waren ausschließlich im Stadtbezirk von D. aufgetreten. Und zwar alle in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Es gab keinen einzigen Fall von Neuerkrankungen.
Außerdem bestanden starke Zweifel, ob es sich überhaupt um eine Krankheit handelte. Bislang konnten keinerlei Krankheitssymptome ermittelt werden. Die einzigen Anomalien waren die grasgrüne Farbe der Haare und die physikalisch absolut unerklärbare Tatsache, dass sich das Haar auf keine Weise schneiden, ausreißen oder sonstwie entfernen ließ.
Obwohl die Lage nicht ganz so schlimm war, wie sie hätte sein können, war doch eine Tatsache nicht wegzuleugnen: Niemand auf dieser Welt hatte eine schlüssige Erklärung für dieses mysteriöse Phänomen. Hier waren Kräfte am Werk, die sich den irdischen Naturgesetzen widersetzten.
Trotz aller beispiellosen Forschungsanstrengungen war das Rätsel nicht zu lösen. Die globale Ordnung drohte aus den Fugen zu geraten. Die ganze Welt war voller Spekulationen und verrückter Hypothesen. Nicht nur seriöse Wissenschaftler, Politiker, Ordnungskräfte und Geheimdienstler hatten Hochkonjunktur; dies war auch die große Stunde für religiöse Fanatiker, Weltuntergangs-Sekten, UFO-Gläubige, Feministinnen und Scharlatane jeglicher Couleur. Eine weltweite Panik war vermutlich nur deshalb ausgeblieben, weil das Mysterium auf den Stadtbezirk von D. beschränkt blieb und keine neuen Fälle von grasgrünen Haaren registriert wurden.
Aber Elfriede Wohlfahrt war eine starke Frau. Sie ließ sich nicht unterkriegen. Sie gestaltete ihren Alltag wie gewohnt, nur dass sie keinen einzigen Schritt mehr vor die Tür ging. Sie hielt sich per Zeitung, Radio und Fernseher auf dem Laufenden.
Auch am Abend des siebten Tages nach der Katastrophe boten die Sondersendungen keine ernst zu nehmenden Neuigkeiten. Nur noch ein Beitrag, dann würde endlich der Spielfilm anfangen. ‚Na, dann hören wir uns in Gottes Namen halt auch noch an, was dieses mickrige Kerlchen zu sagen hat.‘
„Herr Doktor Hänselmann, Sie sind Experte auf dem Gebiet der Attraktivitätsforschung, der Evolutionspsychologie und der Psychologie des Haares. Wie erklären Sie sich dieses Phänomen?“
„Nun, als Wissenschaftler bin ich gewohnt, nüchtern und rational zu denken. Und ich muss zugeben, dass dieses Phänomen einige Aspekte hat, die sich jeder logischen Erklärung entziehen. Aber andererseits gibt es auch ein paar systematische Zusammenhänge, die uns …“
„Welche sind das, Herr Doktor?“
„Einerseits hat diese rätselhafte Erscheinung etwas mit dem Geschlecht zu tun, denn betroffen sind ausschließlich Frauen. Außerdem hat es etwas mit dem Alter zu tun, denn alle betroffenen Frauen sind jenseits der Wechseljahre.“
„Ja, aber …“
„Ja, ich weiß schon, was Sie sagen wollen, Frau Gollenstein. Genau das ist der springende Punkt. Nicht alle älteren Frauen haben grasgrüne Haare. Es ist also nicht allein das Alter. Ich habe alle bekannt gewordenen Fälle analysiert, und dabei ist mir etwas ganz Wichtiges aufgefallen: Alle Frauen, die grasgrüne Haare haben, tragen kurze Haare, die meisten haben diese öden Einheits-Dauerwellen im Urgroßmutter-Look. Aber alle Frauen, die verschont geblieben sind, tragen ihr Haar lang und offen. Dabei scheint die Haarfarbe keine Rolle zu spielen, egal ob blond, braun, grau …“
„Ja, und was schließen Sie daraus, Herr Doktor Hänselmann?“
„Ja, ich weiß, die These ist gewagt, und ich kann selbst kaum so recht dran glauben. Es sieht so aus, als wäre die Evolution beleidigt …“
„Hä? Wie meinen Sie das denn, Herr Doktor?“
…
Sie wollen wissen, wie die Geschichte zu Ende geht?
Die vollständige Geschichte gibt es in dem eBook „Die grasgrünen Haare„. Erhältlich als eBook für Amazon Kindle.
Lesetipp
 Ronald Henss
Ronald Henss
Die grasgrünen Haare
eBook Amazon Kindle
Eine schräge Geschichte für alle, die Haare haben oder auch keine – egal ob blond, braun, schwarz, rot … oder grasgrün.
*
 Ronald Henss und Giuliana Legorano
Ronald Henss und Giuliana Legorano
Die grasgrünen Haare
I capelli verde erba
Deutsch – Italienisch
eBook Amazon Kindle
Eine haarige Kurzgeschichte
Zweisprachig – Bilingue
Deutsch – Italienisch / Tedesco – Italiano
***
© Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Nachdruck und Vervielfältigungen, auch auszugsweise, bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Autors.
***
Stichwörter: Kurzgeschichte, Geschichte, Short Story, Alltag, Friseur, Frisör, Frisur, Haare, Haarfarben, Humor, lustige Geschichte



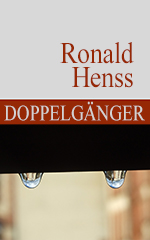


 Ronald Henss und Giuliana Legorano
Ronald Henss und Giuliana Legorano



 Wie sehr liebte sie diese Sprache: Wir hörten von den reichen Dudweiler Steinkohlengruben, von Eisen- und Alaunwerken, ja sogar von einem brennenden Berge, und rüsteten uns, diese Wunder in der Nähe zu beschauen. … Nun gelangten wir zu offnen Gruben, in welchen die gerösteten Alaunschiefer ausgelaugt werden, und bald darauf überraschte uns, obgleich vorbereitet, ein seltsames Begegnis. Wir traten in eine Klamme und fanden uns in der Region des brennenden Berges. Ein starker Schwefelgeruch umzog uns; die eine Seite der Hohle war nahezu glühend, mit rötlichem, weißgebrannten Stein bedeckt; ein dicker Dampf stieg aus den Klunsen hervor, und man fühlte die Hitze des Bodens auch durch die starken Sohlen. … Mehrere Bäume standen schon verdorrt, andere welkten in der Nähe von andern, die, noch ganz frisch, jene Glut nicht ahndeten, welche sich auch ihren Wurzeln bedrohend näherte. Auf dem Platze dampften verschiedene Öffnungen, andere hatten schon ausgeraucht, und so glomm dieses Feuer bereits zehen Jahre durch alte verbrochene Stollen und Schächte, mit welchen der Berg unterminiert ist. Sie wusste, dass sie den Brennenden Berg ganz anders vorfinden würde als der junge Goethe.
Wie sehr liebte sie diese Sprache: Wir hörten von den reichen Dudweiler Steinkohlengruben, von Eisen- und Alaunwerken, ja sogar von einem brennenden Berge, und rüsteten uns, diese Wunder in der Nähe zu beschauen. … Nun gelangten wir zu offnen Gruben, in welchen die gerösteten Alaunschiefer ausgelaugt werden, und bald darauf überraschte uns, obgleich vorbereitet, ein seltsames Begegnis. Wir traten in eine Klamme und fanden uns in der Region des brennenden Berges. Ein starker Schwefelgeruch umzog uns; die eine Seite der Hohle war nahezu glühend, mit rötlichem, weißgebrannten Stein bedeckt; ein dicker Dampf stieg aus den Klunsen hervor, und man fühlte die Hitze des Bodens auch durch die starken Sohlen. … Mehrere Bäume standen schon verdorrt, andere welkten in der Nähe von andern, die, noch ganz frisch, jene Glut nicht ahndeten, welche sich auch ihren Wurzeln bedrohend näherte. Auf dem Platze dampften verschiedene Öffnungen, andere hatten schon ausgeraucht, und so glomm dieses Feuer bereits zehen Jahre durch alte verbrochene Stollen und Schächte, mit welchen der Berg unterminiert ist. Sie wusste, dass sie den Brennenden Berg ganz anders vorfinden würde als der junge Goethe.  Kein dichter Qualm, der aus Felsspalten empor steigt. Keine Hitze, die selbst durch starke Sohlen dringt. Nur noch wenige Spalten, an denen ein schwacher Rauch mit Mühe zu erkennen ist. Die Beschreibung und die Fotos auf der Website hatten ihr eine präzise Vorstellung vermittelt. Sie würde also nicht enttäuscht sein. Sie fieberte dem Moment entgegen, in dem sie an der Stelle stehen würde, die den Dichterfürsten so sehr beeindruckt hatte – genau 233 Jahre später. Und sie freute sich darauf, den Ort und die Sehenswürdigkeiten kennenzulernen, die ihr durch die Website so vertraut geworden waren.
Kein dichter Qualm, der aus Felsspalten empor steigt. Keine Hitze, die selbst durch starke Sohlen dringt. Nur noch wenige Spalten, an denen ein schwacher Rauch mit Mühe zu erkennen ist. Die Beschreibung und die Fotos auf der Website hatten ihr eine präzise Vorstellung vermittelt. Sie würde also nicht enttäuscht sein. Sie fieberte dem Moment entgegen, in dem sie an der Stelle stehen würde, die den Dichterfürsten so sehr beeindruckt hatte – genau 233 Jahre später. Und sie freute sich darauf, den Ort und die Sehenswürdigkeiten kennenzulernen, die ihr durch die Website so vertraut geworden waren.



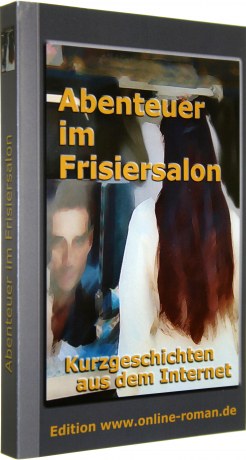 Abenteuer im Frisiersalon
Abenteuer im Frisiersalon Ronald Henss
Ronald Henss

 Als sie schließlich das Licht löscht, sortiert sie im Geiste die wichtigsten Neuigkeiten. Kurz vor dem Einschlafen denkt sie: „Das nächste Mal soll uns Elli mal wieder Reibekuchen backen. Mit viel Apfelmus. Das mag Herr Tanner besonders gern. Und dazu natürlich noch: Dessert wie immer.“
Als sie schließlich das Licht löscht, sortiert sie im Geiste die wichtigsten Neuigkeiten. Kurz vor dem Einschlafen denkt sie: „Das nächste Mal soll uns Elli mal wieder Reibekuchen backen. Mit viel Apfelmus. Das mag Herr Tanner besonders gern. Und dazu natürlich noch: Dessert wie immer.“










 Es war einmal ein edler Prinz, jung, tapfer und schön wie kein anderer je ward gesehn. Das Volk verehrte seinen Prinzen und sehnte den Tag herbei, an dem er eine wunderschöne Braut erwählen und zur Königin des Reiches küren würde. Tief in seinem Innern trug der Prinz das Bild einer Edlen, deren Schönheit alles überstrahlte. Ihr, nur ihr alleine wollte er sein Herz schenken und sie, nur sie wollte er zur Königin und Mutter seiner Kinder machen.
Es war einmal ein edler Prinz, jung, tapfer und schön wie kein anderer je ward gesehn. Das Volk verehrte seinen Prinzen und sehnte den Tag herbei, an dem er eine wunderschöne Braut erwählen und zur Königin des Reiches küren würde. Tief in seinem Innern trug der Prinz das Bild einer Edlen, deren Schönheit alles überstrahlte. Ihr, nur ihr alleine wollte er sein Herz schenken und sie, nur sie wollte er zur Königin und Mutter seiner Kinder machen. Als der edle Prinz eines Tages über den Marktplatz in Dudweiler ritt, geschah das Wunder. Schon aus der Ferne sah er sie. Dort saß in einem offenen Cabriolet, das lockige Haar umhüllt mit einem großen weißen Schleier, eine Braut so edel und schön wie es die Welt noch nie gesehn. Da schwang sich der edle Prinz vom Pferde und schritt auf die Schöne zu.
Als der edle Prinz eines Tages über den Marktplatz in Dudweiler ritt, geschah das Wunder. Schon aus der Ferne sah er sie. Dort saß in einem offenen Cabriolet, das lockige Haar umhüllt mit einem großen weißen Schleier, eine Braut so edel und schön wie es die Welt noch nie gesehn. Da schwang sich der edle Prinz vom Pferde und schritt auf die Schöne zu.
 Als er sie küsste, blendete ihn ein greller Blitz und es ertönte ein Donnerhall und vor ihm stand eine uralte hässliche Hexe. Mit einer scheußlichen Rabenstimme krächzte sie: „Was starrst du mich so an, du Trottel! Ich bin eine verwunschene Hexe und ich warte nun schon Hunderte Jahr‘, auf dass ein dämlicher Prinz mich durch seinen schmierigen Kuss erlöst.“
Als er sie küsste, blendete ihn ein greller Blitz und es ertönte ein Donnerhall und vor ihm stand eine uralte hässliche Hexe. Mit einer scheußlichen Rabenstimme krächzte sie: „Was starrst du mich so an, du Trottel! Ich bin eine verwunschene Hexe und ich warte nun schon Hunderte Jahr‘, auf dass ein dämlicher Prinz mich durch seinen schmierigen Kuss erlöst.“ Und mit lautem Zischen flog die Hexe auf einem Besen durch die Lüfte zum Brennenden Berg, wo sie durch eine Felsspalte ins Bergesinnere verschwand. Dort sitzet sie in der höllischen Glut und schickt heiße schweflig stinkende Rauchschwaden durch die Spalten und Risse im Berggestein.
Und mit lautem Zischen flog die Hexe auf einem Besen durch die Lüfte zum Brennenden Berg, wo sie durch eine Felsspalte ins Bergesinnere verschwand. Dort sitzet sie in der höllischen Glut und schickt heiße schweflig stinkende Rauchschwaden durch die Spalten und Risse im Berggestein. Der edle Prinz aber wurde in einen riesengroßen grünen steinernen Frosch verwandelt und in den Garten der Villa eines Bergwerkdirektors am Fuße des Brennenden Berges verbannt. Dort sitzet der große grüne steinerne Frosch sommers wie winters, tagaus, tagein, bei Wetter und Wind, bei Regen und Schnee, bei Hitze und Trockenheit und wartet, dass ihn ein hässliches Mägdelein küsst. Und wenn ihn keine geküsset hat, so wartet er dort noch heute.
Der edle Prinz aber wurde in einen riesengroßen grünen steinernen Frosch verwandelt und in den Garten der Villa eines Bergwerkdirektors am Fuße des Brennenden Berges verbannt. Dort sitzet der große grüne steinerne Frosch sommers wie winters, tagaus, tagein, bei Wetter und Wind, bei Regen und Schnee, bei Hitze und Trockenheit und wartet, dass ihn ein hässliches Mägdelein küsst. Und wenn ihn keine geküsset hat, so wartet er dort noch heute.
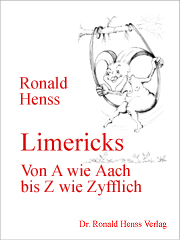 Ronald Henss
Ronald Henss
